Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
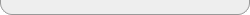
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Störenfriede.
| ISBN | 3850331628 | |
| Autor | Sabine Fellner | |
| Verlag | Brandstätter | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 175 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
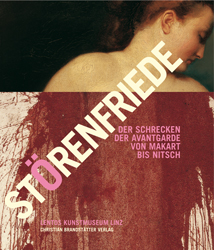
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Max Ernst sah als Kriterium daf├╝r, ob ┬╗ein K├╝nstler verloren sei┬ź, dass er sich nicht gefunden haben d├╝rfe. Protagonisten, die die Kunst gerade dadurch voranbrachten, dass sie sich nicht gefunden hatten, waren die Avantgardisten. Im Gegenteil: Ist es doch gerade Teil ihrer Selbstdefinition, im Rimbaudischen Sinne suchend zu bleiben.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Eine bemerkenswerte Ausstellung im Lentos Kunstmuseum Linz hat 2008 einige der bedeutendsten Avantgardisten ├ľsterreichs pr├Ąsentiert. Man mag einwenden, die Avantgarde sei ein gesamt-europ├Ąisches Ph├Ąnomen - mindestens. Die Beschr├Ąnkung der Ausstellung auf ├ľsterreich ist sinnvoll, kann eine Schau in dem kleinen Land doch aus den Vollen sch├Âpfen: Die ├Âsterreichische Avantgarde, insbesondere der Wiener Aktionismus, spielten innerhalb dieser Kunstrichtung neben der Russischen Avantgarde und dem italienischen Futurismus eine herausragende Rolle.
Neben ihrer permanenten Selbst- und Rollen-Suche kann man Avantgardisten erkennen an ihrer (scheinbar) wechselhaften Biographie. Pars pro toto ist Oswald Wiener. 1968 beteiligte er sich an der Simultanaktion ┬╗Kunst und Revolution┬ź an der Universit├Ąt Wien. Otto M├╝hl las ein Pamphlet ├╝ber die Kennedy-Familie vor, Peter Weibel einen aktionistischen Text ├╝ber den ├Âsterreichischen Finanzminister Koren, Franz Kaltenb├Ąck sprach ├╝ber ┬╗Information und Sprache┬ź. Oswald Wiener hielt einen Vortrag zur ┬╗Input-Output-Relation zwischen Sprache und Denken┬ź. Ein Jahr sp├Ąter ver├Âffentlichte Wiener mit dem Roman ┬╗die verbesserung von mitteleuropa┬ź ein sogenanntes Schl├╝sselwerk der ├Âsterreichischen Nachkriegsliteratur.
Im k├╝nstlerisch-geistigen Gehalt auf der Augenh├Âhe von Charles Baudelaire, verfasste Wiener Anfang der 1980er Jahre einen Basistext zum Dandytum, in dem er sich auch selbst suchte: Der Dandy ┬╗hat verstanden, dass seine ergriffenheiten internen gesetzm├Ąssigkeiten folgen und ihm demnach vorgezwungen sind. Entdeckt die mechanik immer gr├Âsserer teile dessen, das er f├╝r seine freiheit gehalten hat, bis hin zum apparat der verzweiflung. WO IST ICH?┬ź
Die Ausstellung wurde begleitet von einem fulminanten Katalog, der die gezeigten Werke vollst├Ąndig pr├Ąsentiert. Der Bogen reicht vom Fin de Si├Ęcle bis zum Aktionismus 1968. Ausstellung und Katalogbuch vermitteln ein Gef├╝hl f├╝r das Wirken von Kunst. Bei der Avantgarde sind die Reaktionen stets direkter Bestandteil der k├╝nstlerischen Aktion selbst. Bei genauerem Hinsehen ist die Avantgarde allerdings nicht so weit entfernt von anderer Kunst, die diesen Titel nicht verpasst bekommen hat, kann Kunst ohne Kommunikation mit ihrem Umfeld gar nicht stattfinden.
Der l├Ąngst in den Kanon der gro├čen K├╝nstler eingezogene Klimt steht emblematisch f├╝r diesen Prozess einer sp├Ąteren Akzeptanz. Nachdem Klimt Ende des 19. Jahrhunderts beauftragt worden war, f├╝r die Wiener Universit├Ąt drei gro├če Fakult├Ątsbilder anzufertigen, kam es bei deren Pr├Ąsentation zum Rieseneklat mit dem b├╝rgerlich-gesellschaftlichen Establishment. Die Presse griff den Maler f├╝r seine modernen Darstellungen massiv an. Ganze f├╝nf Jahre zog sich die Debatte hin, die damit endete, dass der Maler klein bei gab: Er zahlte die gesamten Vorsch├╝sse zur├╝ck und behielt die Gem├Ąlde.
Irritierend wirkt der Blick auf die Aktionsphotos von G├╝nter Brus. Sein ┬╗Wiener Spaziergang┬ź liegt heute 43 Jahre zur├╝ck. Die Betrachtung der Schwarz-Wei├č-Photos, die das Buch teils ganzseitig dokumentiert, macht den Blick freier auf die Ver├Ąnderung unserer Seh-Gewohnheiten seit ihrer Entstehung. Brus t├╝nchte sich komplett wei├č, mit wei├čem Anzug, wei├čem Gesicht und wei├čen Haaren. Auf ihm verlief eine schwarze Pinselspur ÔÇô vom Scheitel bis zu den F├╝├čen. Die Polizei hielt ihn fest und verh├Ąngte eine Geldbu├če. Auch dies ist in einem s├╝ffisanten Bild festgehalten.
Der kongenial-├Ąsthetisch gestaltete Katalog aus dem Wiener Christian Brandst├Ątter Verlag wird erg├Ąnzt durch vier Textbeitr├Ąge, sie auf intelligente Weise Leuchtfackeln in diesem nicht so einfachen Themenkomplex ┬╗Avantgarde┬ź. Sabine Fellner, von der das Ausstellungskonzept stammt, erl├Ąutert in neun kurzen Kapiteln die beispielhaft ausgew├Ąhlten K├╝nstler in ihren Wirkungs-Zeiten. Instruktiv wird die Bedeutung von provokativer Kunst deutlich, liest man zu welcher Reaktion sich ein Teil des Publikums und der ├ľffentlichkeit jeweils gezwungen sah. Auch die Funktion der Medien bei der Erzeugung von Stimmungen bereits vor hundert Jahren ist retrospektiv erhellend. Herbert Lachmayer erl├Ąutert so kurz wie pr├Ągnant, dass es sich bei den Avantgardisten eigentlich prim├Ąr um individuelle Lebensentwurf-K├╝nstler handelte. Der Hass, der ihnen zum Teil in der Kritik entgegenschlug, ist nicht von ihnen ausgegangen. Abgerundet wird der gro├čformatige Band durch eine Schilderung des Verh├Ąltnisses des Rechtes zur Kunst, das durch eine deutliche Erh├Âhung der Toleranz in den vergangenen Jahrzehnten gekennzeichnet ist.
Die pr├Ąsentierten K├╝nstler waren St├Ârenfriede. Sie dienten dazu, dass die Gesellschaft sich abgrenzen konnte. Sie konnte Grenzen ziehen, sie wurde in die Lage versetzt sich zu definieren. Dazu dienten St├Ârenfriede, Exzentriker, Dandys, Punks zu allen Zeiten: Sie erweisen dem Gemeinwesen einen ungeheuren Dienst. Durch den Katalog wird die herausragende Funktion des provozierenden Elementes in der Kunst sichtbar gemacht. Das Buch ist somit wesentlich mehr als ein Begleiter der Ausstellung. Seine Bedeutung als kleines Vademecum der ├Âsterreichischen Avantgarde bleibt bestehen - auch nach Ablauf der Linzer Ausstellung.
geschrieben am 24.09.2008 | 750 Wörter | 4830 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergńnzungen