Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
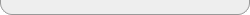
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Die Sichtbarkeit des Bildes
| ISBN | 3593386364 | |
| Autor | Lambert Wiesing | |
| Verlag | Campus | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 319 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |

Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Das Bild als Ding sui generis
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Als Lambert Wiesing Anfang der 1990er Jahre »Die Sichtbarkeit des Bildes« schrieb, das dann im November 1996 in »Rowohlts Enzyklopädie« erschien, hatte die Wissenschaft noch eine andere Begrifflichkeit. Damals war der Begriff der Bildtheorie noch nicht gängig. Heute wird er selbstverständlich zur Klassifizierung dieses theoretischen Standardwerkes benutzt.
Wiesing fordert dazu auf, ein Bild weder wegen des abgebildeten Gegenstands noch wegen der Sichtweise zu betrachten. Erst wenn es ohne diese Motive betrachtet wird, habe die Sichtbarkeit des Bildes eine Chance, hervorzutreten. An vielerlei Beispielen und Denkexperimenten sucht er seine These zu untermauern. So argumentiert Wiesing, der Maler, der ein Haus auf der Leinwand darstellt, würde kein Haus produzieren, ja dies auch gar nicht vorgeben zu tun. Das gemalte Haus entspräche nicht den physikalischen Eigenschaften des wirklichen Hauses. Es wäre weder dreidimensional noch hat es das Gewicht. Das was der Maler täte, wäre höchstens, die Abbildung, eine Vorstellung von einem Haus herzustellen. Der Künstler schaffe so etwas Eigenes, für sich selbst Stehendes.
Aus diesem Grund solle man aufhören – so könnte man Wiesings These vielleicht zuspitzen – in das Bild Zeichen zu interpretieren. »Die radikalste Form eines formalen Bildverständnisses läßt das Bild in seiner Eigenschaft, reine Sichtbarkeit zu sein, aufgehen.« Der Vorteil dieser Sichtweise ist, das Bild auf sich wirken zu lassen. Es hat, anders ausgedrückt, so überhaupt erst eine Chance zu wirken. Zu wirken als Bild, als Ding sui generis und nicht als Interpretation des Dinges, einer Szene, Landschaft oder sonstigem.
Die daran logisch anschließende Frage liefert Wiesing gleich mit: »Welche Bilder werden dieser formalen Ästhetik gerecht? Welche Bilder sind sinnvoll betrachtet, wenn sie nur wegen ihrer Sichtbarkeit betrachtet werden?« Betrachte man so ausschließlich die Sichtbarkeit eines Bildes, so würden die neuen Bildformen des 20. Jahrhunderts verständlich: Von der Collage über den Stummfilm bis zu den Videoclips der 80er und 90er Jahre.
Der Autor ist Professor für Vergleichende Bildtheorie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Lambert Wiesing studierte Philosophie, Kunstgeschichte und klassische Archäologie an der Universität Münster. Er promovierte 1989. Im Jahr des erstmaligen Erscheinens dieses Buches, 1996, wurde er von der Technischen Universität Chemnitz in Philosophie habilitiert.
Bilder prägen uns in der post-postmodernen Massengesellschaft vermutlich mittlerweile stärker als die verbale Sprache. In dem Maße, in dem die Manifestation von Kultur durch Bilder uns bewusst wird, entsteht Klärungsbedarf bezüglich der kulturellen Substanz der Bilder, die uns umgeben. So ist die Suche nach einer kulturellen Essenz in den Bildern ein Hauptanliegen der Kunstwissenschaften geworden. Begriffe wie »Visual Culture« stehen in Tagungsmotti rund um den Globus. So ist Lambert Wiesings Beitrag als eine Art von Antisemiotik zu verstehen, die uns den Blick wieder ein wenig frei macht von gewohnten Denkschablonen. Mit seinem Buch, das eigentlich eine Geschichte der Formal-Ästhetik ist, will er letztlich nachweisen: Im 20. Jahrhundert haben Bilder ihren Zeichencharakter vollständig verloren. An die Stelle der Referenz ist nach seiner Auffassung die Sichtbarkeit getreten. Die Sichtbarkeit der vom Gegenstand abgelösten Form.
Wiesing ist nicht der einzige, der die Bedeutung des Begriffes der Repräsentation für die Bildanalyse ablehnt. Ein wesentliches theoretisches Problem der Antisemiotiker ist, dass sie letztlich doch im Gewässer des semiotischen Paradigmas verbleiben. Aber das ist letztlich nicht vorwerfbar, weil seine theoretische Arbeit zweifelsfrei eine Grenzerweiterung darstellt und er selbst wohl deren Rahmen dennoch nicht bestreiten würde. Andere Fragen bleiben ungeklärt. Sie werden in diesem wissenschaftlichen Bereich bislang kaum wirklich thematisiert: Zum Beispiel die nach dem Entstehen von Bildern im Kopf. Aber das ist natürlich unwissenschaftlich.
geschrieben am 09.09.2008 | 569 Wörter | 3550 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen