Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
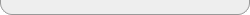
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Schnöde Kunststücke gefallener Geister
| ISBN | 382602124X | |
| Autor | Henriett Lindner | |
| Verlag | Königshausen & Neumann | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 352 | |
| Erscheinungsjahr | 2001 | |
| Extras | - |
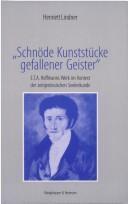
Rezension von
Kristina Scherer
Möchte man das literarische Werk eines Autors analysieren, liefert meist der zeitgenössische Kontext aufschlussreiche Zusammenhänge. So ist es insbesondere auch bei E.T.A. Hoffmann.
weitere Rezensionen von Kristina Scherer

In der vorliegenden Dissertation untersucht die Germanistin Henriett Lindner die Einflüsse der zeitgenössischen Psychologie â zu Lebzeiten des Dichters, Zeichners und Musikers Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) als âSeelenkundeâ bezeichnet â auf das literarische Lebenswerk des Spätromantikers. Wie häufig angenommen geht Lindner davon aus, dass Hoffmann seine psychologischen Kenntnisse ganz bewusst zu Literatur verarbeitet hat.
Das 352 Seiten umfassende wissenschaftliche Werk ist in drei umfangreiche Themenkomplexe unterteilt. Nachdem in der Einleitung die gewählte Methode und der aktuelle Stand der Hoffmann-Forschung dargelegt wurden, folgen Ãberlegungen zum psychologischen wie anthropologischen Diskurs um 1800. Zu Lebzeiten des Meisters des Unheimlichen begann man, seelische Leiden als echte Krankheiten anzusehen und Heilverfahren zu entwickeln. Psychisch erkrankte Menschen wurden nicht mehr wie Kriminelle behandelt. Der renommierte Irrenarzt Philippe Pinel, Leiter der Anstalt zu Bicệtre, befreite seine Patienten 1794 erstmals von den Ketten. E.T.A. Hoffmann selbst besaà gute Kenntnisse der psychiatrischen Medizin, was spätestens seit Paul Suchers Quellenrecherchen nachgewiesen ist. Sein Verleger gewährte ihm Zugang zur Fachliteratur. Während seiner Bamberger Zeit verband ihn auÃerdem eine Freundschaft zu den Nervenärzten Adalbert Friedrich Marcus sowie Franz Speyer, der die medizinischen Ausführungen in Hoffmanns Erzählung âDer Magnetiseurâ beurteilte. Es existieren zwei Schriften, die den Autor bei der Konzeption von psychiatrischen Phänomenen wie etwa den Wahnvorstellungen maÃgeblich beeinflusst haben: die âPhilosophisch-medizinische Abhandlung über Geistesverwirrungen oder Manieâ aus der Feder von Philippe Pinel (1801) und Johann Christian Reils âRhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungâ (1803), die auszugsweise behandelt werden. In diesem ersten groÃen Themenkomplex werden auÃerdem die Thesen Gotthilf Heinrich Schuberts, Johann Gottfried Herders sowie naturphilosophische und magische Theorien behandelt.
In dem zweiten Kapitel setzt sich Henriett Lindner mit der Biographie E.T.A. Hoffmanns auseinander. Dies ist notwendig, um Fakten und Hypothesen zu seinen Kenntnissen der Psychologie liefern zu können. Es wird deutlich, dass zwischen dem zerrissenen Charakter des Autors und seinen Protagonisten erstaunliche Parallelen existieren. Der Spätromantiker sah sich genau wie seine literarischen Figuren stets der Gefahr ausgesetzt, wahnsinnig zu werden. In Bezug auf das Verständnis seiner Wahnsinnsdarstellungen, so Lindner, verfüge Hoffmann über zwei Vorteile gegenüber dem Leser: âEr hat gleichzeitig den Blick eines Wahnsinnigen [...] und [...] den psychiatrisch geschulten Blick eines AuÃenstehenden.â Beide Sichtweisen nutzte er, um in seiner Literatur zwischen objektiver und subjektiver Perspektive zu wechseln und den Rätselcharakter seiner Werke zu erhöhen.
Dem biographischen Zugang folgen Interpretationsbrücken zu den zentralen Texten des Schriftstellers, welche vor dem Hintergrund des psychologischen Diskurses typische Merkmale seiner Prosa aufzeigen. Die thematisch spezialisierten Interpretationen nehmen rund 2/3 des Buches ein. Es werden die Werke âRitter Gluckâ, âDer Magnetiseurâ, âDas öde Hausâ, âDie Elixiere des Teufelsâ, âKlein Zaches genannt Zinnoberâ, âPrinzessin Brambillaâ sowie die beiden Haupttexte zu der psychoanalytischen Interpretation â das Märchen âDer goldene Topfâ und das Nachtstück âDer Sandmannâ â behandelt. Insbesondere der Protagonist letzterer Erzählung weist weitreichende Parallelen zu Disposition und Symptomatik des Wahnsinns auf, die Reil in den âRhapsodienâ beschrieben hat. Berücksichtigt der Leser die zeitgenössische psychiatrische Diskussion, so wird der âSandmannâ â um es mit Freud zu sagen â als eine reale Krankengeschichte nachvollziehbarâ wobei man bedenken muss, dass sich Hoffmann einer verbindlichen Deutung entzieht und \"Der Sandmann\" unterschiedliche Interpretationen geradezu erzwingt. Im Fazit führt Lindner die Bedeutung des Psychologischen in der Literatur aus.
Die dargelegte psychologische Deutung von E.T.A. Hoffmanns Werk ermöglicht ein besseres Verständnis seiner Texte und literarischen Figuren. Nicht zuletzt verschafft dieser Ansatz einen greifbaren Zugang zu der faszinierenden aber oft rätselhaften Hoffmannschen Ãsthetik.
âSchnöde Kunststücke gefallener Geisterâ sei all denjenigen empfohlen, die sich während ihres Studiums mit dem auÃergewöhnlichen Künstler E.T.A. Hoffmann, dem psychiatrischen Diskurs um 1800 oder dem Psychologischen in der Literatur auseinandersetzen möchten. Das Buch ist Pflichtlektüre für eine Seminar- oder Forschungsarbeit zu diesen Themen!
Besonders positiv fallen auÃerdem der gute Schreibstil und der schlüssige Interpretationsvorgang auf, der bei Germanisten leider nicht selbstredend ist. Man ertappt sich zeitweilen dabei, die Abhandlung geradezu zu verschlingen, was vermutlich der gelungenen Mischung aus interessanter Thematik und schriftstellerischer Begabung der Autorin zu verdanken ist.
âSchnöde Kunststücke gefallener Geisterâ lässt sich am besten über die Homepage des Verlags bestellen, da es bei den üblichen Internetanbietern derzeit nicht lieferbar ist: http://www.verlag-koenigshausen-neumann.de
geschrieben am 30.09.2009 | 696 Wörter | 4948 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen