Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
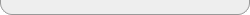
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Kleine Literaturgeschichte der DDR
| ISBN | 3746680522 | |
| Autor | Wolfgang Emmerich | |
| Verlag | Aufbau Tb | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 640 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | Einband Kartoniert/ broschiert |

Rezension von
Johanna Paik
Wolfgang Emmerich hat nun 2007 endlich eine Neuauflage der kleinen Literaturgeschichte herausgebracht.
weitere Rezensionen von Johanna Paik

In acht Kapiteln - zugegeben sehr umfangreichen Kapiteln - schildert Emmerich, was nun so anders ist an der Literatur der DDR, dass man sie nicht einfach als deutsche Literatur bezeichnet und mit der der BRD zusammenfasst.
Dies erkl├Ąrt Emmerich ausf├╝hrlich in seiner Einleitung: Was hei├čt und mit welchem Ziel studiert man DDR-Literatur?
Hier macht Emmerich den Lesern klar, warum es durchaus sinnvoll ist, DDR-Literatur gesondert zu betrachten. Im Gegensatz zur Literatur des Westens waren Autoren in der DDR keineswegs frei in ihren Themen, Inhalten und den Lehren, die sie den Lesern zu geben hatten. Alles war auf die Propaganda des Staates ausgelegt. Nichts durfte an einem Werk verwirren, Geschichten mussten chronologisch aufgebaut sein, der Leser sollte nach M├Âglichkeit gar nicht erst auf die Idee kommen zu denken.
Es scheint fast so, als sei das der Weg zur├╝ck in die Unm├╝ndigkeit, die von Kant so stark, und zwar zu Recht, kritisiert wurde.
Viele Autoren werden hier genannt und n├Ąher vorgestellt. Christa Wolf, Heiner M├╝ller und Berthold Brecht, um nur einige zu nennen. Man erf├Ąhrt, wie sie ├╝ber die Vorgaben dachten, sich als Autoren der DDR f├╝hlten.
Man erf├Ąhrt von der strengen Zensur f├╝r B├╝cher und von den Massen an B├╝chern, die an das Volk verteilt wurden. Man k├Ânnte die DDR gar als Leseland bezeichnen. Kein Haushalt, in dem nicht mindestens zehn B├╝cher standen. Warum auch nicht, schlie├člich waren B├╝cher billig und unterhaltsam.
Am liebsten las man Dorfgeschichten und Liebesromane. Doch waren das nicht die einzigen Themen.
Wie schon oben erw├Ąhnt, hat der Staat vorgegeben, was zu schreiben ist. So gab es gerade anfangs, in der sog. Produktionsliteratur viele Werke, die von der Arbeit erz├Ąhlen. Hier sollte immer ein idealer Held im Vordergrund stehen, der die Leser dazu animiert, seinem Beispiel der Opferbereitschaft und des ganzen Einsatzes f├╝r den Staat zu folgen. Ein sehr ber├╝hmtes Beispiel wird hier auch genannt. Heiner M├╝llers St├╝ck ÔÇ×Der Lohndr├╝ckerÔÇť.
In der kleinen Literaturgeschichte werden viele ber├╝hmte Werke, sowohl im Osten als auch im Westen vorgestellt. Es wird gezeigt, dass es zu Recht eine DDR-Literatur gibt, die bis zur Wende hinein selbstst├Ąndig ist und eine gro├če Leserschaft hatte und hat.
Wer mehr ├╝ber Literatur wissen will, oder auch einfach nur mehr wissen will ├╝ber das Leben in der DDR, dem ist dieses Buch sehr zu empfehlen.
geschrieben am 12.08.2008 | 389 Wörter | 2134 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergńnzungen