Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
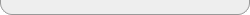
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Oasen der Stille
| ISBN | 3850332314 | |
| Herausgeber | Johann Kräftner | |
| Verlag | Brandstätter | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 167 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
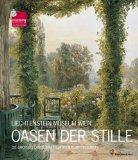
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
In der Gestaltung der LandschaftsgĂ€rten kam es an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zu einem Paradigmenwechsel. Fachleute sprechen von einer Gartenrevolution. Der englische Landsitz wird in dieser Zeit eine (frĂŒh-)liberale Antwort auf die barocke Schloss- und Gartenarchitektur des absolutistischen Frankreich. Bislang hatte der aristokratische Garten vor allem eine reprĂ€sentative Funktion. Der jahrhundertealte Machtanspruch wurde durch eine strenge Hierarchie der architektonischen Ordnung betont. An ihre Stelle trat nun eine sorgfĂ€ltig durchkomponierte Szenerie mit Pagoden, Rundtempeln und Moscheen. Die neue Bewegung des Landschaftsgartens trachtete, der Natur wieder mehr Freiraum zuzugestehen. Gleichzeitig sprach der neue Garten von Weltgewandtheit und sollte die Phantasie anregen. Auch wenn der AnstoĂ dazu aus England kam, war es Frankreich, das einerseits mit seinen Philosophen die Grundlag dieser neuen Denkweise legte. Andererseits kam aus Frankreich auch die formale Ăsthetik: Die englischen GĂ€rten mit ihren antikisierenden Architekturen wurden als »römische Friedhöfe« verspottet.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Eine grandiose Ausstellung im Liechtenstein Museum im Wiener Palais Liechtenstein widmete sich den in dieser Zeit entstandenen LandschaftsgĂ€rten von FĂŒrst Alois I. und dessen Nachfolger Johann I. von Liechtenstein. 250 Graphiken, PlĂ€ne, Photos, Skulpturen und GemĂ€lde wurden gezeigt, die vollstĂ€ndig dokumentiert sind in dem Ausstellungskatalog »Oasen der Stille«.
FĂŒrst Alois I. von Liechtenstein und sein Nachfolger Johann I. reformierten ihre Besitzungen in SĂŒdmĂ€hren grundlegend. Entsprechend des neuen Zeitgeistes von AufklĂ€rung und Ăffnung zum BĂŒrgertum entstand ein Ă€sthetischen AnsprĂŒchen genĂŒgendes Zusammenspiel von Natur und Kunst. Trotz seiner reprĂ€sentativen Rolle sollte der fĂŒrstliche Garten nun auch einen Nutzwert haben. Nicht zufĂ€llig finden sich auf den Stichen und Bildern aus dieser Zeit Pferdewagen und AckergerĂ€te. Eine zweite Entwicklung kam damals zu einem gewissen Höhepunkt: Die Zucht und Weiterentwicklung von Nutzpflanzen und Blumen war en vogue und wurde in vielerlei Fachliteratur besprochen. Der Erfolg der Bestrebungen, neue Pflanzenarten zu zĂŒchten, wurde durch die moderne Glashausarchitektur gefördert. Die Weiterentwicklung von der Orangerie zu immer effektiveren GlashĂ€usern wiederum fand ihren Antrieb durch den erhöhten Bedarf an exotischen Pflanzen.
Die FĂŒrsten des Hauses Liechtenstein spielten in dieser herausragenden Periode in der Geschichte der LandschaftsgĂ€rten eine besonders fortschrittliche Rolle: So begrĂŒndete FĂŒrst Alois im Naturgarten in Eisgrub die erste Pflanzenschule exotischer Forsthölzer in den Erblanden. DarĂŒber hinaus widmete er sich der Zucht schnell wachsender amerikanischer Hölzer.
Welch umfassende Auswirkungen auf die Gestaltung der GĂ€rten der humanistische Nutzanspruch hatte, macht das Buch deutlich: Auf einigen GemĂ€lden, wie auf denen von Ferdinand Runk (1764-1834), sind die Teiche zu sehen, die FĂŒrst Johann I. ausheben lieĂ. In den Teichen der Thaya-Niederungen zĂŒchtete er Karpfen, womit er fĂŒr das FĂŒrstenhaus hohe Erlöse erzielte. Dieser Generation ist bewusst geworden, wie wichtig Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft waren fĂŒr den Fortbestand ihres Adelsgeschlechts. Das bedeutete fĂŒr die Liechtensteins jedoch nicht, dass sie das Flanieren durch ihre Parkanlagen aufgegeben hĂ€tten.
Auch nach dem Untergang des kommunistischen Systems blieben die ehemaligen Besitzungen, die HerrenhĂ€user, Schlösser, Parks und LĂ€ndereien in tschechischem Staatsbesitz. Die Liechtensteins, deren Muttersprache Deutsch war, mussten 1945 die damalige Tschechoslowakei verlassen. Wie bei allen Adligen, so wurde auch ihr gesamter Besitz auf Grundlage der sogenannten Benes-Dekrete entschĂ€digungslos konfisziert. Heute ist es Johann KrĂ€ftner, der Direktor des Liechtenstein Museums Wien, der die alten FĂ€den wieder aufgenommen hat und zu den GĂŒtern in Tschechien guten Kontakt pflegt. Renovierungen der ehemaligen Liechtenstein-HĂ€user werden teilweise durch die Tschechische Republik finanziert, teilweise durch private Spenden. Erst vor kurzem erstanden tschechische KĂ€ufer bei einer Auktion in London 90 GemĂ€lde und MöbelstĂŒcke aus dem Besitz derer von Liechtenstein, die sich frĂŒher im Schloss Valtice befanden. Geplant ist damit dort demnĂ€chst eine Dauerausstellung.
Der kongenial gestaltete Ausstellungskatalog bleibt auch nach Ende der PrĂ€sentation von zeitlosem Wert. GroĂe Tafeln prĂ€sentieren herausragende Beispiele der zeitgenössischen Landschaftsgartenmalerei. Das groĂformatige Buch verdeutlicht die damaligen Bestrebungen einer gebildeten Schicht, Naturverbundenheit mit UrbanitĂ€t in Einklang zu bringen. Heute, wo Oasen der Stille immer seltener zu finden sind, ein schierer Genuss.
geschrieben am 26.11.2008 | 625 Wörter | 4213 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen