Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
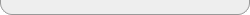
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Der falsche Nero
| ISBN | 374665632X | |
| Autor | Lion Feuchtwanger | |
| Verlag | Aufbau Tb | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 411 | |
| Erscheinungsjahr | 1936 | |
| Extras | - |
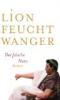
Rezension von
Frowin Jaspers
Inhaltliche Zusammenfassung des Romans „Der falsche Nero“
weitere Rezensionen von Frowin Jaspers

Der Roman spielt zur Zeit des Kaisers Titus in der oströmischen Provinz Syrien. Der ehemalige Senator Varro, der ein Vertrauter des vor elf Jahren verstorbenen Kaisers Nero war, hat sich nach Syrien zurückgezogen, wo er einen starken Einfluss auf die Politik in der Provinz hat, obwohl er unter der neuen flavischen Herrschaft keinerlei Machtbefugnisse mehr besitzt. Als mit dem Gouverneur Cejon ausgerechnet ein alter Schulkamerad und Jugendfeind Varros neuer Verwalter in der Provinz Syrien wird, beginnt Varro sein „Spiel“.
Zwar ausgelöst durch eine übertriebene Steuerforderung des neuen Gouverneurs, ist für Varro hintergründig aber auch der neronische Gedanke der Verschmelzung des Westens mit dem, von ihm so sehr geliebten Osten des römischen Reiches, ein Motiv, das ihn zu seinem „Spiel“ bewegt.
Varro instrumentalisiert einen ortsansässigen Töpfer namens Terenz und nutzt dessen verblüffende Ähnlichkeit mit dem verstorbenen und in der Provinz nach wie vor populären Kaiser Nero, um die Macht des Gouverneurs Cejon zu untergraben. Was zunächst nur als ein kleiner Racheakt für eine übertriebene Steuerforderung Cejons begann, entwickelt allerdings eine Eigendynamik und beginnt dem ehemaligen Senator über den Kopf zu wachsen.
Während Terenz, der „falsche Nero“ und die ehemalige Marionette Varros, sich von diesem zu emanzipieren beginnt, verliert Varro neben vielem Geld auch alles was ihm lieb und teuer ist, darunter seinen Freund Fronto, der in einer Schlacht umkommt, und seine Tochter Marcia, die sich von ihrem Vater abwendet, da er sie gegen ihren Willen mit Terenz/Nero verheiraten lässt.
Dieser baut indes seine Macht aus und übt in der Folge mit seinen Beratern, dem Feldmarschall Trebon und dem ehemaligen Leibeigenen Knops, eine Terrorherrschaft in der Provinz aus, die ihren Höhepunkt in einer Woche der „Messer und Dolche“ erlebt, in welcher politische und persönliche Gegner des Terenz und seiner Anhänger verfolgt und ermordet werden.
Auch nutzt das Triumvirat um Terenz, Trebon und Knops eine, von Knops persönlich veranlasste Überflutung der Stadt Apamea am Euphrat, um die unbeliebte christliche Bevölkerung für diese Tat zu bezichtigen und zu verfolgen. Diese Tat sollte an die Christenverfolgung Kaiser Neros erinnern und die Machtstellung des „falschen Neros“ in der Bevölkerung stärken.
Schneller als der Aufstieg des Regimes erfolgt aber sein Sturz. Der Widerstand in der Bevölkerung nimmt seinen Anfang in einem Schmählied, dessen rasche Verbreitung weder Terenz noch seine Mitstreiter zu verhindern im Stande sind:
„Ein Töpfer, der hat ein Ding gedreht, ein sehr großes Ding gedreht, das Ding dreht sich.
Die kleine Acte kam ins Land herein und nahm sein Ding in Augenschein, sein Ding geht nicht.
Ein Töpfer, der gehört in die Rote Gasse zu seiner Tonmasse, nicht zur Herrenklasse.
Und wenn ein Töpfer nicht weiß, wohin er gehört, dann wird er belehrt, vom Kaiser belehrt, sehr
deutlich belehrt, bis er weiĂź, was los ist, was klein und was groĂź ist.
Darum, gewisser Töpfer, mach dich klein, zieh den Schwanz ein, sonst kommt der Kaiser herein und
fängt dich.
Und dann ist's zu spät, dein Ding ist ausgedreht, er hängt dich.“
Der wachsende Widerstand in der Bevölkerung und die letztlich absehbare Weigerung des Partherkönigs Artaban, Nero und seinen Anhängern Schutz vor Rom zu gewähren, zwingt die Tyrannen schließlich zur Flucht, welche aber misslingt und zu ihrer Gefangennahme führt. Terenz, Trebon und Knops werden, in der Verkleidung eines dreiköpfigen Hundes, durch die Straßen getrieben und von der Bevölkerung verschmäht, bespuckt, geschlagen und schlussendlich gekreuzigt.
„Der falsche Nero“ als eine zeitgenössische Kritik gegen den Faschismus
Schon während des ersten Lesens des „falschen Nero“ stößt man unausweichlich auf zahlreiche Analogien zu Personen, Ereignissen und Entwicklungen des nationalsozialistischen Deutschlands, also zu eben jener Zeit, in der Feuchtwanger seine Arbeit am „falschen Nero“ begann und abschloss. Feuchtwanger setzte sich schon vor seiner Zeit im Exil mit dem Faschismus in Deutschland auseinander und erklärte zum Ziel seiner Arbeit die Bekämpfung des Nationalsozialismus. In seinem 1931 verfassten Aufsatz „Wie kämpfen wir gegen ein Drittes Reich?“ charakterisierte er ein mögliches „Drittes Reich“ als eines der „Ausrottung der Wissenschaft, der Kunst, des Geistes“
Feuchtwanger wählte für seinen Kampf gegen den Faschismus die Form des historischen Romans, welche er nach eigener Aussage als eine Waffe im „Kampf gegen die Dummheit und Gewalt“ betrachtete. So kann der historische Roman bei Feuchtwanger in den Bereich des politischen Pamphlets eingeordnet werden.
Im „falschen Nero“ gibt es eine regelrechte Sammlung von Parallelen zu verschiedenen Elementen und Merkmalen des Nationalsozialismus. Angefangen beim Töpfer Terenz, der Feuchtwanger als satirische Darstellung Adolf Hitlers dient, mit der er sich bemühte, „Hitler so trocken und leidenschaftslos wie möglich darzustellen, dh. zu zeigen wie so ein kleiner Fisch so sehr stinken kann.“ Feuchtwanger geht es demnach bewusst um eine Entmystifizierung Hitlers, indem er ihn als so „normal“ wie nur möglich darstellt, aber auch auf dessen lächerliche Selbstinszenierung hinweist.4
Die Mitstreiter des Töpfers stehen ebenso stellvertretend für führende Vertreter des NS-Regimes wie Terenz. Man kann durch die, bis ins Detail beschriebenen Eigenschaften von Knops und Trebon, diese unzweifelhaft als Joseph Goebbels und Hermann Göring identifizieren.
So beschreibt Feuchtwanger Trebon als „laut, vulgär, prunkvoll“ und Knops als „mit allen Wassern gewaschen“ und „ehrgeizzerfressen“.
Neben der Darstellung des „dreiköpfigen Höllenhundes“, ihrer Rivalitäten und Intrigen, ihrer Grausamkeit und Brutalität, weist Feuchtwanger im Laufe der Handlung auch immer wieder auf die Schwächen eines jeden einzelnen hin und gibt sie nach und nach der Lächerlichkeit preis, welche sich in dem Schmählied abbildet, dass vor dem endgültigen Sturz des Regimes in der Bevölkerung die Runde macht. Durch die Darstellung der wenigen Figuren, die im Roman erscheinen, versucht Feuchtwanger zu demonstrieren, dass im Faschismus keine „normale menschliche Identität“ existieren kann, sondern dass jeder, der an dem System teilhaben möchte, „ein Schauspieler, ein Lügner, eine Marionette“ sein muss.
Des Weiteren finden sich im Roman zwei deutliche Analogien zu Ereignissen in Deutschland nach der Hitlerschen Machtergreifung. Die von Knops im Geheimen angeordnete Überflutung und Zerstörung der Stadt Apamea, sowie die anschließende Schuldzuweisung und Verfolgung der Christen, steht für den Reichstagsbrand vom 28. Februar 1933 und die im Zuge der sogenannten Reichtagsbrandverordnung veranlasste Verfolgung von Kommunisten.
Die Verteidigungsrede des Christen Joannes von Patmos erinnert an die Verteidigung von Georgi Dimitroff während des Reichstagsbrandprozesses in Leipzig, in der es Dimitroff, wie Joannes von Patmos, gelang einen Freispruch für sich zu erwirken und den, von den Nazis erhofften propagandistischen Schauprozess zu einem Debakel für das Regime werden ließ.
In der, sich dem Verbrechen an der Stadt Apamea anschließenden „Woche der Messer und Dolche“ wurden nicht nur die Christen, sondern auch politische und persönliche Gegner verfolgt und ermordet: „Der Kaiser unterzeichnete die Dokumente, die Knops und Trebon vorlegten, und sie bildeten also […] kleine Trupps, die sie „Rächer Neros“ nannten und mit denen sie über ihre Feinde herfielen.“
Schon der Titel des entsprechenden Kapitels „Die Woche der Messer und Dolche“ soll an die sogenannte „Nacht der langen Messer“ erinnern. Dieser Begriff umfasst die, im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches einsetzende Verfolgungs- und Ermordungswelle in Deutschland im Sommer des Jahres 1934. Auch hier wurden, getreu dem Motto „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ zahlreiche politische, innerparteiliche und persönliche Gegner verfolgt und ermordet. Feuchtwanger stellt dabei vor allem die Willkür heraus, mit welcher Namen auf die „Todes-Liste“ gesetzt oder von dieser wieder gestrichen wurden.
Selbst die im Roman beschriebene anfängliche Zurückhaltung Roms und des Kaisers Titus lässt eine Verbindung zu der Appeasement-Politik der europäischen Großmächte vor dem 2.Weltkrieg zu.
Kritik am „falschen Nero“
Als erster Kritiker an Feuchtwangers „falschem Nero“ trat Arnold Zweig auf, der mit Feuchtwanger einen regen Austausch durch Briefwechsel pflegte. Zweig lobte Feuchtwanger für dessen Schreibstil, den Aufbau der Handlung und den Spaß, den der Roman dem Leser bereite. Doch kritisierte er den Roman als „zu willkürlich und individualistisch angefasst.“
Zweig sieht keine hinreichende Rechtfertigung für das „Spiel“ des Varro und bemängelt, dass alle soziologischen Voraussetzungen des Dritten Reiches, denen entgegengesetzt seien, die Varro vorfinde, also eine durch Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und politische Instabilität gekennzeichnete Weimarer Republik auf der einen, und ein aufsteigendes, kraftvoll zusammengefasstes Regime der Flavier auf der anderen Seite.
Es existiere demnach ein starker Widerspruch zwischen den Voraussetzungen für die Machtergreifung des „falschen Nero“ und für die Machtergreifung Hitlers, und so stehe die Erzählung „auf ungenügenden Pfeilern – auf Pfeilern, die die Analogien der Fabel nicht tragen, weder die gegenwärtigen noch die antiken.“
Zweig bemängelt, dass das, für das Dritte Reich charakteristische Phänomen der Massenbewegung im Roman an keiner Stelle aufgegriffen wird und der Leser über Ursachen und Gründe des demagogischen Erfolgs Hitlers in keinster Weise aufgeklärt werde.
In die Kritik an der Individualisierung der Geschichte stimmt auch Georg Lukács ein. Ihm fehlt in dem Roman eine Analyse der Ursachen, die zum Dritten Reich führten.
„Wie war es möglich, dass hier eine Bewegung entstand, in der Tausende und Abertausende überzeugter Menschen fanatisch für die Sache dieser feilen und mörderischen Söldner des Kapitalismus gekämpft haben? Das Rätsel dieser Massenbewegung, das Rätsel dieser Schmach für Deutschland enthüllt der satirische Roman Feuchtwangers eben nicht. Es wird in ihm als eine einfache Tatsache hingenommen, dass das Volk zeitweilig auf plumpeste Demagogie hereinfällt.“
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Darstellung Hitlers als Terenz/Nero. Obwohl es das erkärte Ziel Feuchtwangers war, „Hitler so trocken und leidenschaftslos wie möglich darzustellen, dh. zu zeigen wie so ein kleiner Fisch so sehr stinken kann.“, störte sich Bertolt Brecht an eben genau dieser Darstellung. Für Brecht ist die Konzeption Feuchtwangers, Hitler als einen Hampelmann darzustellen und zu veralbern, eine typisch bürgerliche Konzeption, die er selbst jedoch ablehnt, da man Hitler nicht bekämpfe, indem „man ihn als besonders unfähig, als Auswuchs, […] hinstellt und ihm die anderen bürgerlichen Politiker als Muster, unerreichte Muster vorhält.“ Die Literaturwissenschaftlerin Angela Vaupel nimmt den Kritikpunkt der zu „einseitigen Darstellung und der Simplifizierung Hitlers“ auf, verweist im Zuge dessen aber auch auf die „bewusste Entmystifizierung“ Hitlers, die Feuchtwanger erzielen wollte.
Fazit
Seinem Anspruch als satirischer Roman auf der einen und als politisches Pamphlet auf der anderen Seite wird „Der falsche Nero“ in weiten Teilen gerecht. Die Figuren Terenz, Knops und Trebon zeugen, als Analogien zu Hitler, Goebbels und Göring, von einer guten Beobachtungsgabe Feuchtwangers. Alle drei Figuren lassen sich leicht identifizieren und die, durch die beschriebenen Eigenschaften der Figuren ständigen Wiedererkennugsmerkmale bereiten dem Leser große Freude. Tatsächlich gelingt Feuchtwanger so eine „Entmystifizierung“ Hitlers und nimmt dem Leser, wie erhofft, den Respekt, die Ehrfurcht und vielleicht auch etwas die Angst vor dem Tyrannen. Das angewandte Doppelgänger-Motiv diente auch anderen satirischen Darstellungen Hitlers, wie zum Beispiel in Charlie Chaplins „Der große Dikator“ oder Ernst Lubitschs „Sein oder Nichtsein“.
Doch erzeugt Feuchtwanger nicht ausschließlich Hohn und Spott, angesichts dieser, zumeist der Lächerlichkeit preisgegebenen Akteure. Die Schilderung der Überflutung Apameas und der „Woche der Messer und Dolche“ löst beim Leser in erster Linie Entsetzen und Ekel aus, angesichts der menschenverachtenden Skrupellosigkeit des Regimes. Auch verschafft der Roman dem Leser ein solidarisches Gefühl mit den, vom Regime verfolgten Unschuldigen. Dies ist insofern sehr wichtig, da Feuchtwanger als Exil-Autor, dessen Werke in Deutschland verboten waren, eigentlich nur Leser aus dem Ausland, also beispielsweise aus England, Frankreich, den USA oder der Sowjetunion erreichen konnte.
Allerdings kann man die Kritik, es fehle dem Roman an einer Ursachenanalyse, nicht ignorieren. Dieser Punkt ist ein Makel des Romans, denn tatsächlich steht dieser historische Roman so „auf ungenügenden Pfeilern – auf Pfeilern, die die Analogien der Fabel nicht tragen, weder die gegenwärtigen noch die antiken.“
Schließlich waren die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umstände der Weimarer Republik von maßgebender Bedeutung für die Entwicklung Deutschlands hin zum Faschismus, während Feuchtwanger derartige Voraussetzungen in seinem Roman nicht aufgreift. Auch auf die Antike bezogen fehlt es dem Roman an einer ausreichenden Erklärung für das Zustandekommen und für den Erfolg eines „falschen“ Neros. Die Gründe für eine gewisse Popularität Neros in den oströmischen Provinzen finden kaum Erwähnung. Stattdessen beruht alles auf dem „Spiel“ eines einzelnen Mannes, welches dieser aufgrund eines persönlichen Zwists und des recht wolkigen Wunsches, den Osten mit dem Westen zu verschmelzen, startet.
Auch die Kritik, im Roman fehle das Phänomen der Massenbewegung, trifft voll und ganz zu, da eben diese als charakteristisch für das Dritte Reich zu kennzeichnen ist. So ist die Machtbasis des Terenz eine andere als die Hitlers und so werden dem Volk in Feuchtwangers Roman im Verlauf der Geschichte zwei verschiedene und widersprüchliche Rollen zuteil. Zunächst erscheint das Volk als dumm und anfällig für die Demagogie, ohne dass hinreichende Gründe für eine solche Anfälligkeit gegeben werden. Doch sorgt dieses Volk dann später, mit der Verbreitung eines Schmähliedes, für den Anfang vom Ende des Regimes.
Lion Feuchtwangers „Der falsche Nero“ ist somit eine zwar durchaus ansprechende Satire, die eine gewichtige Rolle in der anti-faschistischen Literatur spielt, doch bietet der Roman weder besondere Erkenntnisse, noch eine historisch relevante Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Man muss allerdings mit einbeziehen, dass Feuchtwanger als Zeitzeuge und als persönlich Betroffener, einem anderen Bewertungskontext unterlag, als die Menschen, die sich heutzutage mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen.
geschrieben am 01.04.2009 | 2112 Wörter | 13177 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen